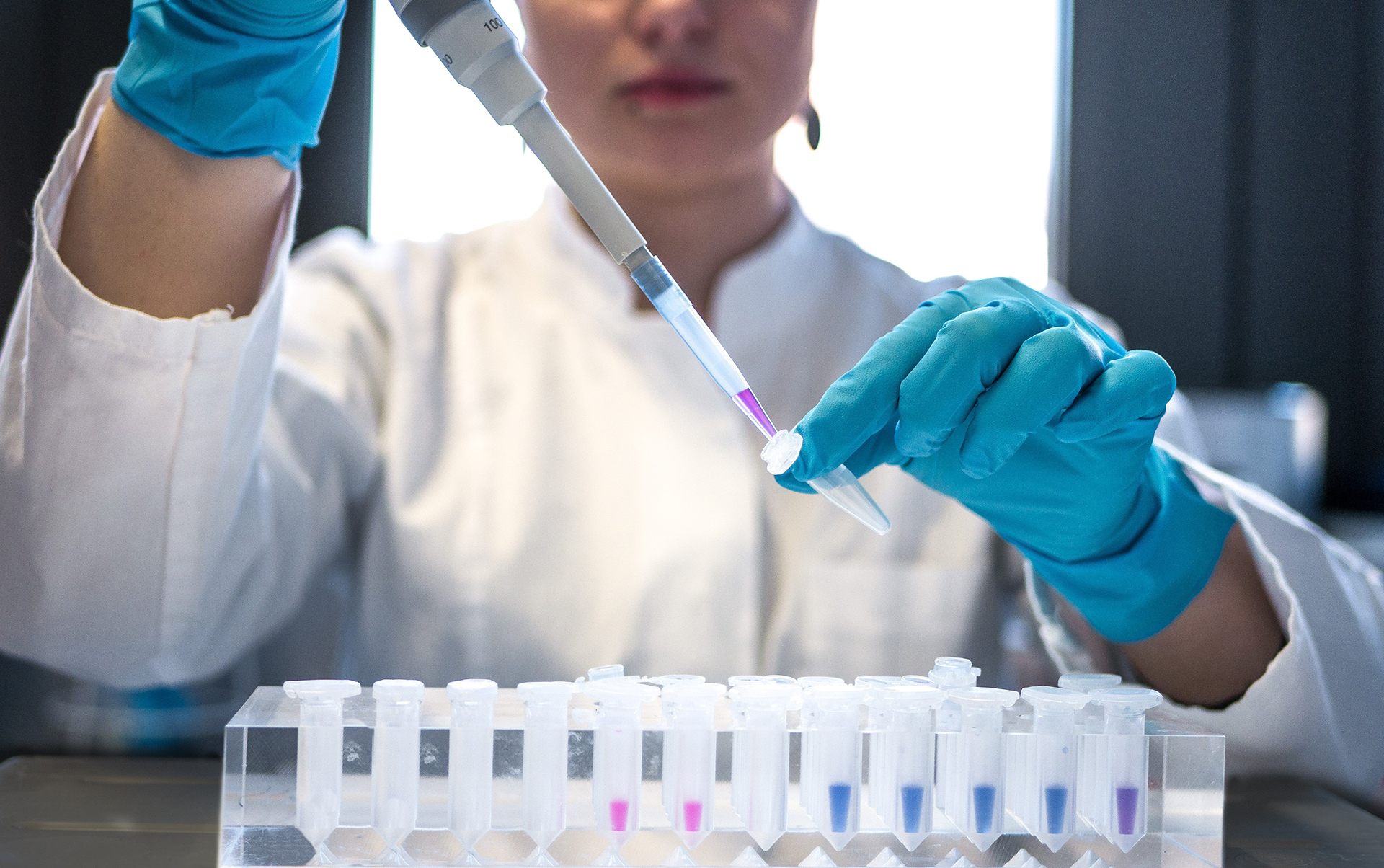Bisherigen Forschungsergebnissen zufolge erkranken geimpfte Männer tendenziell schwerer an Covid-19 als geimpfte Frauen, was auf geschlechtsspezifische Impfreaktionen hinweist. Frauen entwickeln oft viel stärkere länger anhaltende Antikörperantworten und reagieren in der Folge mit stärkeren Impfreaktionen, was die Frage nach angepassten – sprich reduzierten – Impfdosen aufwirft. Gängige Praxis ist jedoch die Verabreichung ein und derselben Dosierung für alle Erwachsenen. Doch ich fragte mich: Warum ist das so? Und welche Folgen gehen mit den Folgen der Gender Data Gap einher?
Die männliche Norm
Schon die alten Griechen sahen im männlichen Körper die unumstößliche Norm. Frauenkörper galten als Abweichung von diesem Ideal, als nach innen gekehrte minderwertige männliche Körper. Eierstöcke und Uterus wurden dementsprechend auch nicht als eigene weibliche Geschlechtsorgane, sondern weibliche Hoden und weiblicher Hodensack klassifiziert. Mittlerweile ist zumindest anerkannt, dass es einen von der männlichen Anatomie unabhängigen weiblichen Körper mit eigenen Charakteristika gibt. An der Formel Mann = Mensch hat sich jedoch wenig geändert.
Gender Data Gap: Begriff und Problematik
Medizin und Forschung leiden noch immer an einer klaffenden Gender Data Gap – einer geschlechterbezogenen Datenlücke in medizinisch relevanten Datenerhebungsverfahren, üblicherweise zu Ungunsten der Frauen. Es werden zu wenig oder überhaupt keine Daten weiblicher Probandinnen in medizinischen Studien erhoben, was Forschungsergebnisse einseitig verfälscht und in der Konsequenz Frauen benachteiligt.
Um die Gender Data Gap etwas anschaulicher zu machen, habe ich hier ein kleines Beispiel für euch: Herz-Kreislauferkrankungen sind weltweit die häufigste Todesursache bei Frauen. Dennoch liegt der Anteil weiblicher Probandinnen bei herzbezogenen Studien nur bei 24 %. Daraus folgt: Männliche Symptome wie Brustenge und ausstrahlende Schmerzen in den rechten Arm gelten als „typisch“ für einen Herzinfarkt, weibliche Symptome wie Oberbauchschmerzen, Schweißausbrüche oder Übelkeit werden dagegen viel zu spät als solcher diagnostiziert. Studien zufolge erhalten Frauen mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % doppelt so häufig wie Männer eine Fehldiagnose, was falsche Behandlungen nach sich zieht und mitunter tödliche Folgen haben kann.
Trotz gesetzlicher Vorschriften kaum geschlechtsspezifische Studien
Zwar besteht seit 2004 die gesetzliche Pflicht, „eventuelle“ Unterschiede zwischen Frauen und Männern im Rahmen klinischer Prüfungen in Deutschland zu ermitteln- und seit 2011 müssen Arzneimittelhersteller zusätzlich eine geschlechtsspezifische Auswertung ihrer Studien einreichen und veröffentlichen, die Realität sieht jedoch anders aus. ProbandEN dominieren nach wie vor Studien zu Medikamentenwirkungen, und die Pharmaindustrie behandelt Frauen weiter als kleine Männer, obwohl sich deren Körper nachweislich bis auf die Zellebene hinab unterscheiden.
Wo fängt die Datenlücke eigentlich an? Interview mit zwei Medizinstudentinnen
Doch wer, wenn nicht die Ausbildungsstätten unserer künftigen Ärzt*innen wären besser in der Lage, diese Datenlücke zu schließen? Um herauszufinden, wie viel Raum Gender im Medizinstudium bekommt, habe ich mit zwei Medizinstudentinnen gesprochen. Zuerst wollte ich wissen, welche Abbildungen in den einschlägigen Lehrbüchern dominieren und ob hier ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Frauen- und Männerkörpern besteht.
„Das kommt ganz aufs Lehrbuch an“, erzählt Celina, aktuell im 9. Semester an der Humboldt-Universität. „Die Anatomielehrbücher sind schon ziemlich geschlechtsspezifisch und enthalten immer männliche und weibliche Abbildungen. Bei den inneren Organen ist das eher weniger der Fall, obwohl es interessant wäre, zu wissen, ob sich deren Größe und Lageposition je nach Geschlecht unterscheiden“. Das Buch „Die Standarduntersuchung“, ein gängiges Medizinlehrbuch zu den verschiedenen Untersuchungsmethoden, enthalte jedoch ausschließlich Bilder von Männern. „Das ist schon auffällig“, meint Celina. Die einzige Ausnahme hiervon bildet die Untersuchung weiblicher Geschlechtsorgane.
Mich interessierte zudem, ob gendergerechte Medizin in ihrem Studium überhaupt thematisiert wird. „Geschlechterforschung ist für die meisten medizinischen Fächer super wichtig, was auch versucht wird, in der Lehre zu vermitteln“, erklärt sie. Die Charité lege auf diese Thematik besonderen Wert und integriere Gendermedizin systematisch in ihr Curriculum. Es gibt sogar ein eigenes Team speziell für Geschlechterforschung sowie eine regelmäßige Beratung für Dozierende zur Integration genderbezogener Lehrinhalte. In wiederkehrenden Arbeitssitzungen werden Erfahrungen und Ergebnisse reflektiert, Informationen ausgetauscht sowie zukünftige konkrete Schritte geplant, um die Lehre nachhaltig zu verbessern.
Bereits im Rahmen der Einführungswoche gibt es eine Pflichtveranstaltung zu klinischen Aspekten von Sex und Gender, das Wahlpflichtmodul „Sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung“ sowie später ein komplettes vierwöchiges Modul zu geschlechtsspezifischen Erkrankungen. Letzteres sei allerdings Alleinstellungsmerkmal des Modellstudiengangs an der Charité und keinesfalls Usus.
Auch bei der Interpretation der Studienergebnisse werden Diversity-Aspekte wie Alter, Geschlecht und Ethnizität diskutiert, und bei eigenen Hausarbeiten werden die Studierenden dazu angehalten, geschlechtsspezifische Datenerhebung mit einzubeziehen. Der bereits genannte charitéeigene Forschungsbereich Gender in Medicine (GIM) ist zudem intensiv an der Lehre beteiligt und wirkt bei der Konzeption von Lehrveranstaltungen zu wissenschaftlichem Arbeiten mit.
Dennoch gibt es auch an der Charité einige Lücken. So werden Krankheitssymptome nicht immer nach Geschlecht aufgeschlüsselt vermittelt, und insbesondere bei den Themen Medikamentendosierung und -nebenwirkungen gab es bisher keine Hinweise zu potenziellen Unterschieden und damit einhergehenden Anpassungen an den weiblichen Körper, kritisiert Celina.
Auch Henriette, die gerade ihr fünftes Semester an der Friedrich-Schiller Universität in Jena absolviert, bestätigt, dass bestimmte Krankheitsbilder nach wie vor zu stark an der männlichen Norm orientiert sind. Man bekomme einfach die „typischste“ Symptomatik vorgesetzt und müsse dann später in der Praxis selbst herausfinden, was bei welchem Geschlecht verstärkt auftritt.
Gender Medizin ist für alle gut
Jetzt könnte MANN sich denken, die Gender Data Gap ist zwar unschön, aber betrifft mich persönlich ja nicht wirklich, also sehe ich auch keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. Tja, weit gefehlt! Schließlich ist es kein Zufall, dass Depressionen oder auch Osteoporose bei Männern tendenziell schlechter und zu spät diagnostiziert werden, sondern unmittelbare Folge einseitiger Datenerhebungen. Psychologische Studien basieren überproportional auf Daten weiblicher Probandinnen, und Osteoporose gilt nach wie vor als „Frauenkrankheit“, was die Betroffenheit von Männern negiert und Diagnose sowie Therapie behindert. Geschlechtergerechte Medizin ist also gerade kein „Frauenthema“. Im Gegenteil: ALLE Geschlechter profitieren von ihr, weshalb es umso wichtiger ist, dass wir uns geschlossen dafür stark machen.
Von Carolin Beinroth
Foto: Julia Koblitz/unsplash
Weiterführende Empfehlungen
Falls der Artikel euer Interesse geweckt hat und ihr euch gern intensiver mit der Thematik auseinandersetzen wollt, hier noch zwei kleine Empfehlungen:
Das Buch „Unsichtbare Frauen“ von Caroline Criado-Perez durchleuchtet neben Medizin und Forschung verschiedenste gesellschaftliche Bereiche auf ihre Geschlechtergerechtigkeit und kommt immer wieder zu dem erschreckenden Schluss: die Hälfte der Weltbevölkerung wird viel zu oft ignoriert.
Aber auch der MDR hat vor Kurzem einen interessanten Beitrag zum Thema „Gendermedizin – Wie Frauen in der Medizin vergessen werden“ veröffentlicht, verfügbar in der ARD-Mediathek. Die persönliche Geschichte von Frau Sigrid Beyer, die bereits seit 50 Jahren nach einer Diagnose für ihr Herzleiden sucht, macht die Problematik noch einmal greifbarer. Den Link hierzu findet ihr in den Quellen.
Mehr erfahren?
In unserem Blog, auf Facebook, bei Instagram und auf Youtube und in unserem Newsletter beleuchten wir alltägliche Themen, innovative Ansätze und Möglichkeiten, neue Wege zu gehen.