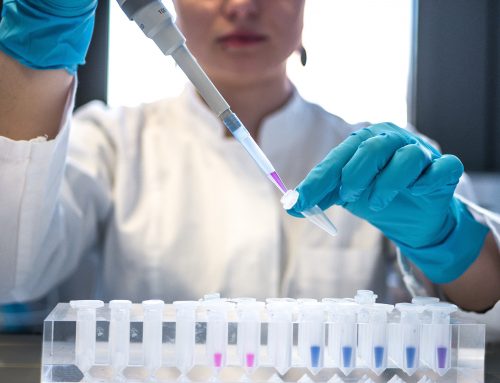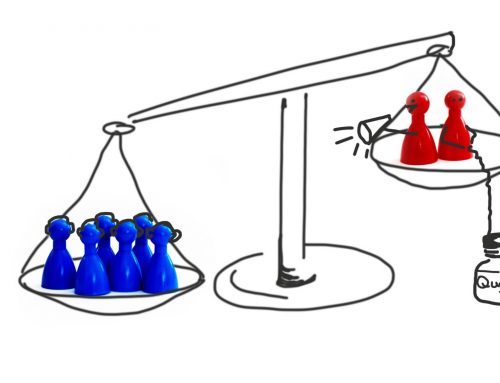„Brandenburg – wir mischen uns ein“: Elke Stadeler, Bürgermeisterin von Strausberg
„Wie schaffen Sie denn da noch Ihren Haushalt?“ wurde Elke Stadeler gefragt, als sie 2010 die erste Bürgermeisterin Strausbergs wurde. Als Finanzökonomin hatte sie lange die Kämmerei geführt, bevor sie das höchste Amt der Stadt annahm. Ihre Wiederwahl 2018 zeigt, dass die Bürger mit dieser Frau an ihrer Spitze zufrieden sind.
Frau Stadeler, warum sind Sie Bürgermeisterin geworden?
Ich habe schon 30 Jahre in der Verwaltung gearbeitet, 20 Jahre davon in der Stadtverwaltung Strausberg, wo ich die Kämmerei, also einen Kernbereich geleitet habe. Da hat man viele Kontakte und man muss sich natürlich einbringen – zwar nicht politisch –, aber Ziel ist es, die Fachlichkeit in die Politik zu bringen. Und wenn man dann von Bürgern gefragt wird „Mensch, du kannst das doch, warum kandidierst du denn nicht?“, überlegt man und sagt: „Stimmt, warum denn nicht? Probieren kannst du es mal“.
Was denken Sie, war der Grund für Ihre Wähler*innen, Ihnen ihre Stimme zu geben?
Ich war damals für den Haushalt zuständig, der konsolidiert werden musste. Denn wir waren wirtschaftlich nicht so wahnsinnig gut aufgestellt. Da habe ich sehr viel Kraft reingegeben, stand oft in der Kritik und damit auch in der Zeitung. Ich war in vielen Ausschüssen und Versammlungen unterwegs und habe für die Stadt kämpfen müssen. Das hat die Leute vermutlich überzeugt. Ich denke, bei einigen kam dazu, dass sie sagten: Wir möchten mal eine Frau als Bürgermeister. In Strausberg gab es bis dato noch keine Bürgermeisterin. Es war sicher nicht der Hauptgrund, aber bei manchen war der Gedanke, dass Frauen das vielleicht ein wenig anders angehen. Dass ich in keiner Partei bin, war sicher auch gut. Das brachte eine gewisse Neutralität.
Wie kam es, warum haben Sie sich keiner Partei angeschlossen?
Ich war noch nie in einer Partei. Ich bin ja in der DDR geboren und großgeworden, aber Partei, das war immer das Binden an eine Vorgabe. Das widerspricht meinem Naturell. Ich kann mich nicht unterordnen und etwas machen, nur weil es die Masse sagt. Wenn du einer Stadt dienen darfst, in der viele Menschen einer Partei angehören, macht es die Arbeit sicherlich einfacher. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich muss mir jedes Mal aufs Neue meine Partner suchen. Natürlich sind mir einige Parteien näher als andere. Und es gibt immer ein paar Leute, bei denen ich sage: Mit denen könnte ich gut zusammenarbeiten. Letztendlich sollte es bei kommunaler Arbeit immer um die Sache gehen.
Wie sieht Ihr typischer Arbeitstag aus?
Ich stehe sehr früh auf, um halb sechs. Dann laufe ich so 3,8 Kilometer im Wald. Wann ich nach Hause komme, hängt von den Abendterminen ab. Heute habe ich zum Beispiel um 19.30 Uhr den letzten Termin, morgen um 18.30 Uhr, wenn die Stadtverordnetenversammlung tagt, dauert es erfahrungsgemäß bis 22 Uhr.
Auch an den Wochenenden gibt es viele Termine, die der Stadt zugutekommen, zum Beispiel die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr am Samstag. Nun trage ich zwar keine Uniform, bin aber dafür verantwortlich, dass unsere Freiwillige Feuerwehr die besten Rahmenbedingungen erhält.
Ich habe allerdings auch den Ehrgeiz, alle Fachausschüsse zu begleiten. Nicht zu führen, aber dabei zu sein, um den Kollegen den Rücken zu stärken und um bestimmte Sachen zu wissen. Manche sagen, ich sei omnipräsent, andere beschweren sich, wenn ich mal nicht da bin. Dem gerecht zu werden, ist schon schwer.
Setzen Sie andere Prioritäten als Ihre männlichen Kollegen?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, männliche Kollegen sind gradliniger. Wir Frauen wollen allem gerecht werden. Ich habe es zum Beispiel noch nicht geschafft, mal länger Urlaub zu machen. Da kommt mal der Minister, da ist mal dieses, mal jenes Highlight. Mir fällt es schwer, zu sagen: Jetzt bin ich weg. Ich merke aber auch, dass Frauen anders wahrgenommen werden als Männer – auch von Frauen selbst. Man muss sich den Respekt sehr hart erarbeiten.
Denken Sie, darin liegt der Grund, warum in Brandenburg nur 9,1 % aller Bürgermeister*innen (Amtsrät*innen, etc.) Frauen sind?
Das kann schon sein. Frauen haben Angst, den Anforderungen nicht gerecht, vorgeführt oder beleidigt zu werden. Wir ducken uns gern ein, lassen uns immer wieder beeindrucken. Gerade Männer in der Politik treten selbstbewusst und stark auf. Wir brauchen oft Feedback, Männer nicht. Männer können 5 Prozent, die restlichen 95 kommen dann auch irgendwie. Wir können 95 Prozent und zweifeln, ob wir die restlichen 5 irgendwie schaffen. Aber das ist Quatsch.
Was müsste sich ändern, damit mehr Frauen in eines dieser Ämter gewählt werden bzw. sich zur Wahl stellen?
Die Gesellschaft. Das sage ich ganz knallhart. Als ich mit der politischen Arbeit begann, waren die Kinder schon aus dem Haus. Meine Ehe hält seit 35 Jahren. Da sind die Rahmenbedingungen also gut. Als ich die erste Wahlperiode antrat, fragte mich eine Mitarbeiterin: „Wie schaffen Sie denn Ihren Haushalt?“ Ich habe zurückgefragt, ob sie das auch von meinem Vorgänger wissen wollte. „Nee, der hat ja ‘ne Frau“. Das sagt eigentlich alles. Die Leute denken oft immer noch in diesen Kategorien.
Was mir auffällt: Bei uns Frauen wird sehr aufs Äußere geachtet. Wir müssen immer top aussehen, auch nach einem Zehn-Stunden-Tag. Wenn du da ein wenig kaputt wirkst, heißt es sofort: Kann die nicht auf sich achten? Schauen Sie sich mal an, wie man über Angela Merkel redet. Auch wenn man politisch vielleicht nicht übereinstimmt, aber ich finde, sie macht das sehr souverän. Wenn Männer fertig aussehen, ist das halt so. Bei Frauen wird da immer drauf geschaut. Und wir setzen uns da selbst sehr unter Druck.
Was ist wichtig für dieses Amt?
Gute Nerven. Ich habe noch nie in meinem Amt geweint. Ich werde beschimpft, ich werde beleidigt, ich werde herablassend behandelt. Man muss in sich selbst sehr stark sein. Ich gehe dann lieber eine Runde im Wald laufen. Körperliche Stärke braucht es auch. Und man muss auf jede Regung, auf jede Haltung achten, gerade in der Arbeit mit den Medien.
Ein Beispiel: Ich war ganz frisch im Amt und wurde von einem Berufsfotograf fotografiert. Er hat mich, um meinen Vorgänger richtig ins Bild zu setzen, von hinten fotografiert. Gefühlt das halbe Zeitungsbild zeigte meine Kehrseite. Ein viertel Jahr später komme ich zu einer Veranstaltung und höre einen Mann, der zu seiner Frau sagt: „Die hat ja einen ganz normales Gesäß.“ Und sie: „Habe ich dir doch gesagt. Das war nur bescheuert fotografiert!“ Da merkst du, wie sich sowas einbrennt. Damals war es beschämend. Heute kann ich darüber lachen.
Was möchten Sie in Ihrer Gemeinde erreichen?
Was ich möchte, ist, dass die Leute zufrieden sind. Und zwar nicht nur, weil wir eine Kita oder eine Schule bauen. Jeder hat sein unmittelbares Bedürfnis. Wenn ich keine Schulkinder habe, interessiert mich Schule nun mal weniger. Ich möchte, dass die Leute sagen: „Ich wohne in einer tollen Stadt. Das läuft hier.“ Mit diesem höher, schneller, weiter tun wir uns in Deutschland nichts Gutes. Wenn mal etwas nicht läuft, ist die nächste Frage immer: Wer hat Schuld? Nicht: Was machen wir, um das Problem zu lösen? Da würde ich mir mehr Zufriedenheit wünschen.
Das Gespräch führte Mariana Friedrich.
Foto: Julia Otto
Unsere Blogreihe „Brandenburg – wir mischen uns ein“
Im zweiten Jahr unseres auf fünf Jahre angelegten Projektes „Brandenburg – ich misch’ mich ein: Für mehr Frauen in der Politik“ geht es um die politischen Strukturen. Und wer kennt die besser als diejenigen, die bereits mitmischen? In unserer Blogserie „Brandenburg – wir mischen uns ein“ stellen wir jeden Monat eine starke Frau vor, die sich im Land Brandenburg einbringt und mitgestaltet. Auf welche Hürden trifft sie dabei? Was hindert Frauen ihrer Meinung nach, sich politisch zu engagieren? Und wo brauchen wir gerade weibliche Perspektiven? Sie verraten es uns.